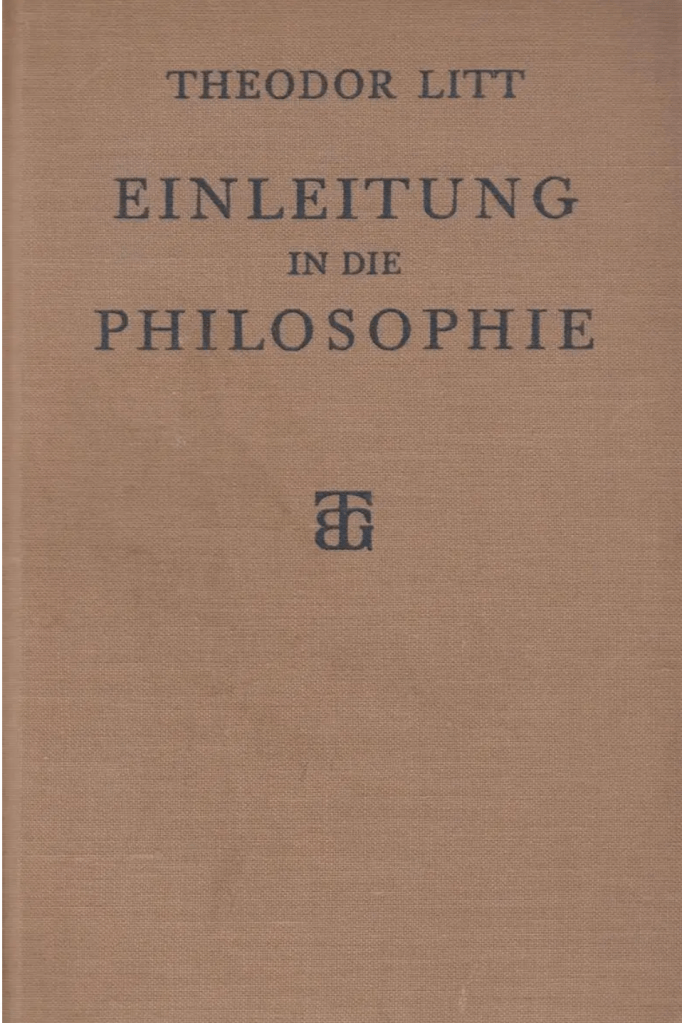„Die Luft verändert sich – fein Säure – Luft – mein Gesicht – Ausdruck – Konsistenz“ – Was war das? Zugegeben, ich war etwas müde, aber meine Augen schienen wie haltlose Flummis über die Buchseite zu hüpfen, hier und da ein Wort treffend, hin und her, vor und zurück, und lieferten diesen Wortsalat, aus dem ich keinen Sinn entnehmen konnte. Etwas beunruhigt versuchte ich, meinen Blick auf der Seite zu fixieren. Wo ist das Verb? Haben diese Sätze keine Verben? Der erste Satz hatte doch eins: „verändert sich“, aber danach? Und wie hing das zusammen? Ich richtete mich etwas auf und las den Abschnitt noch mal. Jetzt ergaben die Sätze Sinn, aber sie sagten mir nichts: Die Rede von der Luft und der feinen Säure – woran knüpfte das denn an? Na gut, es handelte sich um den Anfang des Romans. Da dürfen die ersten Sätze schon mal kryptisch sein, aber das Unbehagen wollte sich nicht ganz auflösen. “Eine ängstliche Teilnahmslosigkeit“ – das gehört nicht nur in den Roman, das gab mein Gefühl wieder, das mich beschlich, als ich merkte, dass ich mich nicht in den Text hineinfinden konnte. Meine Augen sprangen weiter hin und her. Abermals wies ich mich zurecht und zwang mich, aufmerksam, ja: aufmerksam, weiterzulesen. Nach ein paar Minuten und einige Absätze weiter rastete es ein, mein gewohnter Lesefluss kam zurück und ich tauchte ein in die Welt, die der Text mir suggerierte.
Nach vielen Jahren las ich endlich mal wieder einen Roman, jedenfalls hatte ich es mir fest vorgenommen. Deniz Ohde: Streulicht, erschienen 2020. Nach dieser anfänglichen Verunsicherung, dem Wortsalat, vergewisserte ich mich nochmal durch einen Blick auf den Klappentext:

Konsistenz ist ein Kraftakt, schoss es mir durch den Kopf. Es ist nicht so leicht, die Wörter zu sinnvollen Einheiten zu verbinden. Linearität und Interpunktion helfen natürlich. Aber dazu dürfen die Augen nicht wandern, und auch die Gedanken müssen beim Geschriebenen bleiben, oder? Oder müssen die Gedanken umherirren, um das Verständnis durch die Verknüpfung mit Gefühlen und eigenen Erfahrungen zu konturieren? Das Lesen war mir entglitten, zwar nur für ein paar müde Augenblicke, aber hinreichend verunsichernd. Ich wälzte mich hin und her. Erinnerte mich ans Gitarre-Üben: Wenn etwas nicht klappt oder blöd klingt, Metronom langsam stellen und ganz ruhig von vorn beginnen; das Tempo erst steigern, wenn es gut klingt. Beim Lesen war es jetzt genauso.
Aber die Verunsicherung war jetzt latent geblieben. War das neu? Könnte es an COVID liegen? Viele Leute hatten von kognitiven Einschränkungen erzählt. Oder lag es doch daran, dass ich seit vielen Jahren keinen Roman mehr gelesen hatte? Nur noch Fachbücher, und das meist am Schreibtisch, oft sogar nur in digitaler Form. Es mir hingegen bequem machen, ein Buch aufschlagen und für viele Stunden so verharren und lesen, das hatte ich ewig nicht getan. Warum eigentlich? An Lust mangelte es eigentlich nicht, an Lesestoff auch nicht. Natürlich hatte ich wenig Zeit, aber seien wir ehrlich: Wer hat die schon?! So recht erklären konnte ich mir das also nicht. Aber wenn der Habitus erstmal gebrochen ist, ist es schwer, neu zu beginnen. Zu Beginn dieses langen Lese-Hiatus war allerdings etwas viel einfacheres geschehen. Meine Sehkraft hatte nachgelassen. Wenn ich nicht ausreichend Licht oder Abstand zum Text hatte, war es eine große Anstrengung. Irgendwie war das leicht beängstigend und mir war gleich der Linguistikdozent aus Bochum wieder eingefallen, der seine letzte Vorlesung damit begonnen hatte, von seinem schwindenden Augenlicht zu sprechen. Das Lesen am Bildschirm brachte diese Probleme nicht mit sich. Aber erst, als ich mir nach einigen Jahren eine Lesebrille gekauft hatte, konnte ich mich zum Lesen wieder betten. Und erst vor drei Tagen war Streulicht eingetroffen, das ich dann geradezu rauschhaft verschlungen hatte.
Es fällt mir noch immer schwer zu sagen, was diesen Text so fesselnd und besonders macht. Sicher, es ist ein moderner Bildungsroman, der auch als Autosoziobiografie gehandelt wird. Doch das Poetische scheint mir das Soziologische zu übertreffen. Vor allem ist der Text voller Ambivalenzen, die für die Protagonistin ebenso offen zu bleiben scheinen wie für die Leserschaft, also zumindest für mich:

Die Rede vom „Gesicht“ ist geradezu leitmotivisch. Das Kapitel hebt an mit: „Mein Gesicht war etwas, das ich verstecken wollte.“ Was für ein Satz! Was für eine Selbstbeobachtung! Hören wir hier die spätere Reflexion der Erzählerin oder die Formulierung der beschriebenen Protagonistin? Eine Formulierung, die zwar mit dem Wunsch harmoniert, „[e]ine unverfängliche, alltägliche Geschichte“ zu erzählen, doch nicht mit der verletzlichen Exponiertheit, die die Erzählerin mit dieser biografischen Verallgemeinerung präsentiert. Und geht es denn für die Protagonistin wirklich um Unverfänglichkeit oder nicht doch oder zumindest ebenso sehr um das im Sturz beinahe verletzte Auge? Zumal auf letzteres in der Schilderung einer Narbe unterm Auge zum Ende des Romans nochmals rekurriert wird („Das schwindende Kollagen führte auch dazu, dass langsam eine Narbe sichtbar wurde unter meinem linken Auge“, heißt es 155 Seiten später). Oder war die Narbe doch von dem Hundebiss, der bereits zu Beginn erwähnt wird? (Aber der Arzt hatte doch versichert, dass „nichts zurückbleiben“ werde.) So legen sich die Möglichkeiten der verschiedenen Lesarten und auch der Selbstinterpretationen der Protagonistin und Erzählerin fortschreitend wie Schichten übereinander, ohne dass sie zwingend auf eine bestimmte Schicht reduziert würden. Von der “Sauberkeit und Sorgfalt” will ich gar nicht erst anfangen.
Wie nach Filmen bin ich immer auch bei Romanen gespannt, nachher Besprechungen zu lesen, um den inneren Dialog auszuweiten. Eine habe ich bisher gelesen. Und das barsche und meines Erachtens irrige Urteil am Ende ärgert mich so sehr, dass ich mich innerlich an eine Replik mache.
Aber während ich dies schreibe, bin ich mir sicher, dass ich dem Reichtum dieses Romans nie gerecht werden könnte. Nicht mal mit geübten Augen. Aber weiterlesen will ich. Den nächsten Roman.